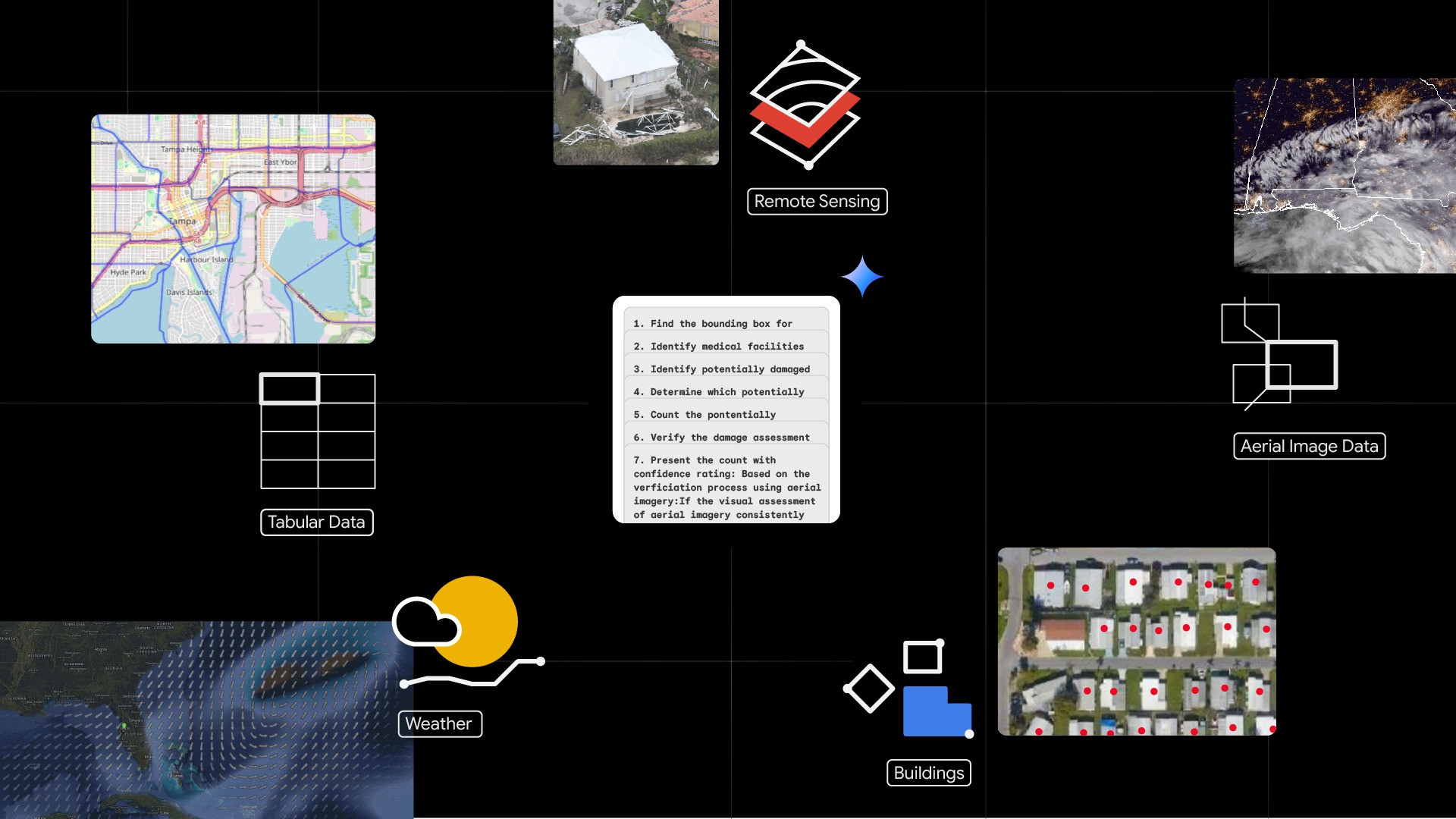Die Europäische Zentralbank (EZB) abgesenkt Die Leitzinsen wurden am Donnerstag um einen Viertelpunkt auf 3 Prozent gesenkt, was die vierte Senkung in diesem Jahr darstellt. Diese Entscheidung fällt in eine Zeit, in der politische Entscheidungsträger zunehmende Bedenken hinsichtlich der wirtschaftlichen Aussichten der Eurozone und der globalen Handelsunsicherheiten zum Ausdruck bringen.
Die Europäische Zentralbank senkt die Zinsen auf 3 Prozent
Die politischen Entscheidungsträger hatten die Zinsen seit Juni gesenkt, um die Inflation in Richtung ihres 2-Prozent-Ziels zu steuern. Der aktuelle Inflationsdurchschnitt lag im November bei 2,3 Prozent und lag damit aufgrund steigender Energiepreise leicht über den Vormonaten. Die EZB geht davon aus, dass die Inflation im kommenden Jahr auf durchschnittlich 2,1 Prozent sinken wird.
Christine Lagarde, die Präsidentin der EZB, bemerkte während einer Frankfurter Pressekonferenz, dass zwar Fortschritte bei der Inflationsbekämpfung erzielt wurden, die Situation jedoch „noch nicht erfüllt“ sei. Beamte dachten über eine deutlichere Senkung um einen halben Prozentpunkt nach, einigten sich aber letztendlich auf eine Senkung um einen Viertelpunkt und betonten, dass das Tempo der Zinsanpassungen von den laufenden Wirtschaftsbewertungen abhängt.
Trotz erheblicher Fortschritte bei der Inflationskontrolle, die Ende 2022 einen Höchststand von über 10 Prozent erreichte, drohen weitere Risiken für die Wirtschaft der Eurozone. Die Erwartung höherer Zölle auf europäische Waren, die in die Vereinigten Staaten exportiert werden, eine Möglichkeit, die der gewählte Präsident Donald J. Trump angesprochen hat, sorgt für eine weitere Ebene der Unsicherheit. Darüber hinaus verschärft die politische Instabilität in Deutschland und Frankreich – den beiden größten Volkswirtschaften der Union – die Situation.
Im vergangenen Jahr haben verschiedene Interessengruppen Bedenken hinsichtlich der nachlassenden Wettbewerbsfähigkeit Europas geäußert. Es ist unklar, wie die europäischen Staats- und Regierungschefs die notwendigen Reformen koordinieren werden. Der zunehmende Druck auf die EZB, die Wirtschaft zu unterstützen, wird durch niedrige Wachstumsprognosen noch verstärkt. Die Mitarbeiter der Zentralbank haben die Wachstumserwartungen für die Eurozone für das nächste Jahr auf 1,1 Prozent gesenkt, verglichen mit einer früheren Prognose von 1,3 Prozent vor drei Monaten.
Im Gegensatz dazu haben die Anleger ihre Erwartungen hinsichtlich der Geschwindigkeit künftiger Zinssenkungen angepasst. Sie spekulieren, dass die EZB den Einlagensatz bis zum Frühjahr 2025 auf 2 Prozent senken könnte, obwohl einige Bedenken aufkamen, nachdem Lagarde in ihren Äußerungen betonte, dass der Kampf gegen die Inflation noch andauere. In jüngsten Gesprächen äußerte Fabio Panetta, der Gouverneur der Bank von Italien, Bedenken hinsichtlich der Möglichkeit, dass die Inflation unter das Ziel der EZB fallen könnte, und erklärte, dass „restriktive monetäre Bedingungen nicht länger notwendig“ seien.
Die Aussicht auf erhöhte Spannungen im Welthandel – aufgrund erwarteter US-Zölle – könnte die Wirtschaft der Eurozone dämpfen und sich insbesondere auf Sektoren wie das verarbeitende Gewerbe auswirken. Es wächst die Sorge, dass ein Handelskrieg das Wirtschaftsvertrauen und die Verbraucherausgaben beeinträchtigen könnte, die für die Erholung von entscheidender Bedeutung sind.
Jüngste Erklärungen der EZB spiegeln das Bewusstsein für diese Herausforderungen wider, wobei Lagarde die rasche Umsetzung „konkreter und ehrgeiziger Strukturpolitiken“ fordert. Diese sollten auf Vorschlägen früherer Führungspersönlichkeiten wie Mario Draghi, der sich für eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit einsetzte, und Enrico Letta, der sich für die Stärkung des Binnenmarkts einsetzte, aufbauen.
Lagarde bekräftigte die Notwendigkeit verschiedener Mitwirkender, um diese Probleme anzugehen, und betonte: „Jeder muss seinen Job machen.“ Sie betonte, dass die Zentralbank bei der Lösung der wirtschaftlichen Herausforderungen der Eurozone nicht die Rolle eines „Alleskönners“ übernehmen dürfe. Die Komplexität der Situation legt nahe, dass weitere Maßnahmen sowohl seitens der politischen Entscheidungsträger als auch der Ökonomen unerlässlich sein werden, um die anhaltenden Unsicherheiten zu bewältigen.
Hervorgehobener Bildnachweis: Alexey Larionov/Unsplash